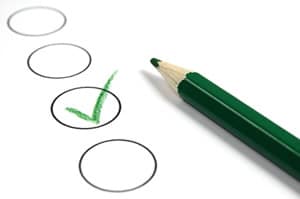Luther in Leipzig und die Disputation von 1519

Die Reformation, die vor über einhundert Jahren ihren Anfang nahm, war ein Ereignis, das viel mehr als nur die Kirche betraf. Es hatte enorme politische Auswirkungen, die sogar noch heute in Europa zu erkennen sind. Zentraler Mann der Reformation war Martin Luther. Der 1517 seine berühmten Thesen an die Württembergische Schlosskirche geschlagen hat und sich damit gegen den kirchlichen Ablasshandel positionierte. Es kamen Dinge ins Rollen, die die Kirche und damit auch Europa nachhaltig verändern sollten.
Ein Baustein der Reformation war die Disputation, die 1519 in Leipzig stattfand. Dabei hat es sich um ein Streitgespräch gehandelt, bei dem auch Luther mit vor Ort gewesen ist, um die neue Wittenberger Theologie zu verteidigen. Diese Disputation gilt als wichtiger Schritt der Reformation, die mittlerweile ihr 500. Jubiläum feiern konnte, da sie maßgeblich zur Meinungsbildung in der Bevölkerung beitrug. Zudem markiert dieses Ereignis auch den endgültigen Bruch zwischen Luther und der katholischen Kirche. Mehr zu diesem Thema gibt es in diesem Artikel zu erfahren.
Die Reformation und Martin Luther in Leipzig
Rund eineinhalb Jahre nach dem Anschlagen seiner 95 Thesen in Wittenberg fand in Leipzig die Disputation statt. In diesem Zeitraum gab es viele Gelegenheiten für Luther und andere Reform-Befürworter, ihre Ideen zu verbreiten. Das war unter anderem auch deshalb möglich, da zu dieser Zeit Landesherrn versuchten, die Kontrolle der Kirche zu minimieren. Ins Jahr 1519 fiel nicht nur die Disputation, sondern auch die damalige Kaiserwahl, in der Karl V. zum römisch-deutschen König wurde und bis zur Kaiserkrönung 1930 als “erwählter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches” galt. Die Zeit war von einem generellen Reformgedanken geprägt, bei dem Humanismus und die Renaissance wichtige Rollen spielten.
Luthers Anliegen traf also auf offene Ohren, obschon diese eben eher außerhalb der Kirche zu finden waren, während es innerhalb der kirchlichen Kreise viel Gegenwind gab. Entsprechend wurden auch die Häresie-Prozesse gegen Luther in Gang gebracht. Prozesse in denen er der Ketzerei beschuldigt wurde. Das Jahr 1519 war diesbezüglich eine Zuspitzung dieser Ereignisse, die dann öffentlich im Leipziger Streitgespräch ausgesprochen wurden. Eine weitere wichtige Person war dabei Johannes Eck, mit dem Luther zuvor einen Briefwechsel hatte, der eine freundschaftliche Verbindung ergab. Allerdings entfernte man sich im Verlauf der nächsten Monate voneinander, womit die Idee zu einem öffentlichen Streitgespräch geboren wurde. So viel ist bekannt, es ist kein Liedwettbewerb der Kirche geworden.
Planungen zum Luther Kongress in Leipzig
Die Idee der Disputation stammte von Andreas Bodenstein, der als Karlstadt bekannt war und zu dieser Zeit Dekan der Theologischen Fakultät der Universität in Wittenberg gewesen ist. Er selbst hat zusätzliche Thesen veröffentlicht, mit denen er sich gegen die Gedanken von Johannes Eck gewandt hat. Obschon Eck und Luther zu diesem Zeitpunkt noch eine gute Verbindung hatten, führte die Veröffentlichung von Karlstadt dazu, dass sich Eck noch klarer positionierte. Er veröffentlichte im August 1518 eine eigene Verteidigungsschrift. Damit einhergehend wurde eine Disputation vorgeschlagen, sodass daraufhin die strittigen Fragen zwischen ihnen vom apostolischen Stuhl sowie den Universitäten aus Paris, Köln und Rom geklärt werden könnten. Man einigte sich auf Leipzig als Austragungsort.
Im Vorfeld der Disputation spitzte sich die Situation zu. Unter anderem durch ein Flugblatt, das von Karlstadt und Lucas Cranach dem Älteren hervorgebracht wurde. Danach veröffentlichten beide Seiten immer wieder neue Thesen, in denen es vor allem um die katholische Kirche und die Vormachtstellung des Papstes ging. Luther berief sich eher auf die alte Kirche, die den Inhalten des Neuen Testaments näher stand. Er äußerte sich zudem kritisch zu der jüngeren Kirche. Er arbeitete dabei sehr wissenschaftlich, nutzte aber auch eine Sprache, die eher für die Öffentlichkeit gedacht war. Besonders weil sein Ziel darin bestand, die Diskussion über das Akademische herauszubringen.
Das Streitgespräch von 1519

Eck musste sich in diesen Tagen sowohl mit Karlstadt als auch Luther in Leipzig disputieren. In den Gesprächen mit Karlstadt ging es inhaltlich um den freien Willen und dessen Bezug zur Gnade Gottes. Allerdings wurde da auch schon deutlich, dass es viel eher um die Gespräche zwischen Luther und Eck ging, die auch öffentlich von größerem Interesse gewesen sind. Karlstadts Auftritt wurde eher als solide betrachtet, allerdings ging Eck aus dem Thema auch nicht als ganz klarer Sieger hervor. Somit stand jetzt aber das Streitgespräch zwischen ihm und Luther an.
Die Disputation zwischen Luther und Eck
In der Disputation zwischen Luther und Eck wurden verschiedene Fragen behandelt. Diese wurden teilweise aber nicht chronologisch diskutiert. Unter anderem ging es um die Schriften, die aus den ersten Jahrhunderten des Christentums stammen und wie sie sich zueinander verhalten. Zudem ging es oft um die Autorität des Papstes und des Konzils und welche Tradition es diesbezüglich gegeben hat. Grundsätzlich bestand also die Frage, wie sich die neuere mit der traditionellen Kirche verbinden ließe. Auch rational-politische Aspekte der Kirchenverfassung wurden diskutiert.
Als Höhepunkt gilt die Abschlussrede von Martin Luther in Leipzig. Welche beinahe nicht stattgefunden hätte, da Eck am letzten Tag eine so lange Rede hielt, dass Luther nicht mehr zum Zug kam. Daraufhin wurde Einspruch eingelegt und das Streitgespräch wurde um zwei Tage verlängert. Am nächsten Tag hielt Luther seine Rede, in der er noch einmal bekräftigte, dass er nicht die Oberhoheit der römischen Kirchen anzweifeln würde, sondern nur deren Herleitung aus einem göttlichen Recht. Der besondere Clou: Luther wechselte in der Rede ins Deutsche und wandte sich damit direkt an die Öffentlichkeit. Ein Regelverstoß mit großer Wirkung.
Die Folgen der Disputation
In der Folge der Streitgespräche sollten Urteile gefällt werden, wobei hierbei die Universitäten von Paris und Erfurt ins Spiel kamen. Jedoch erklärte Erfurt keine der beiden Seiten zu einem Sieger. Das tat auch die Pariser Universität nicht, verurteilte allerdings die Schriften von Luther. Abseits der akademischen Wirkung brachte die Disputation aber auch öffentlich einen Stein ins Rollen. Luthers Worte kamen in der Öffentlichkeit und vor allem bei den Humanisten sehr gut an. Letztendlich hat die öffentliche Wirkung sogar dafür gesorgt, dass die offiziellen Ergebnisse stark in den Hintergrund rückten. Im Nachgang gab es einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen Luther und Eck.
Verschiedene Seiten versuchten, den Sieg der Disputation für sich zu vereinnahmen, andere hielten das Streitgespräch für gescheitert. Luther positionierte sich danach sogar noch klarer und nahm die Position ein, dass alle von Jan Hus gesagten Sätze mit dem christlichen Glauben in Einklang standen. Hus war ein Theologie und Reformator aus Böhmen gewesen, der der Ketzerei beschuldigt wurde und am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Die Verbindung von Hus zu Luther hatte zuvor schon Eck vorgebracht und wollte Luther damit diskreditieren. Luther in Leipzig deutete es aber für sich um und bildete damit einen wichtigen Grundstein für den lutherischen Protestantismus.
Die Disputation in der Kunst und Leipzig
Zur Leipziger Disputation kann im Detail noch viel mehr geschrieben werden, doch feststeht, dass sie für die Reformation eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, da sie auch Martin Luthers Profil geschärft hat. Erst vor kurzem wurden 500 Jahre Reformation gefeiert, wozu es viele verschiedene künstlerische Beiträge gab. Unter anderem auch ein Liedwettbewerb zum Reformationsjubiläum. Die Kunst hat sich zuvor aber auch schon mit dem Leipziger Streitgespräch beschäftigt. Unter anderem gibt es eine berühmte Radierung von Gustav König und ein Ölgemälde von Carl Friedrich Lessing mit dem Titel “Disputation zwischen Luther und Eck auf der Pleißenburg zu Leipzig”. In Leipzig hat man 2017 einen Erinnerungsort zum Gedenken dieses Ereignisses eingerichtet. Dieser befindet sich am Neuen Rathaus.
Fazit zu Luthers Leipziger Disputation von 1519